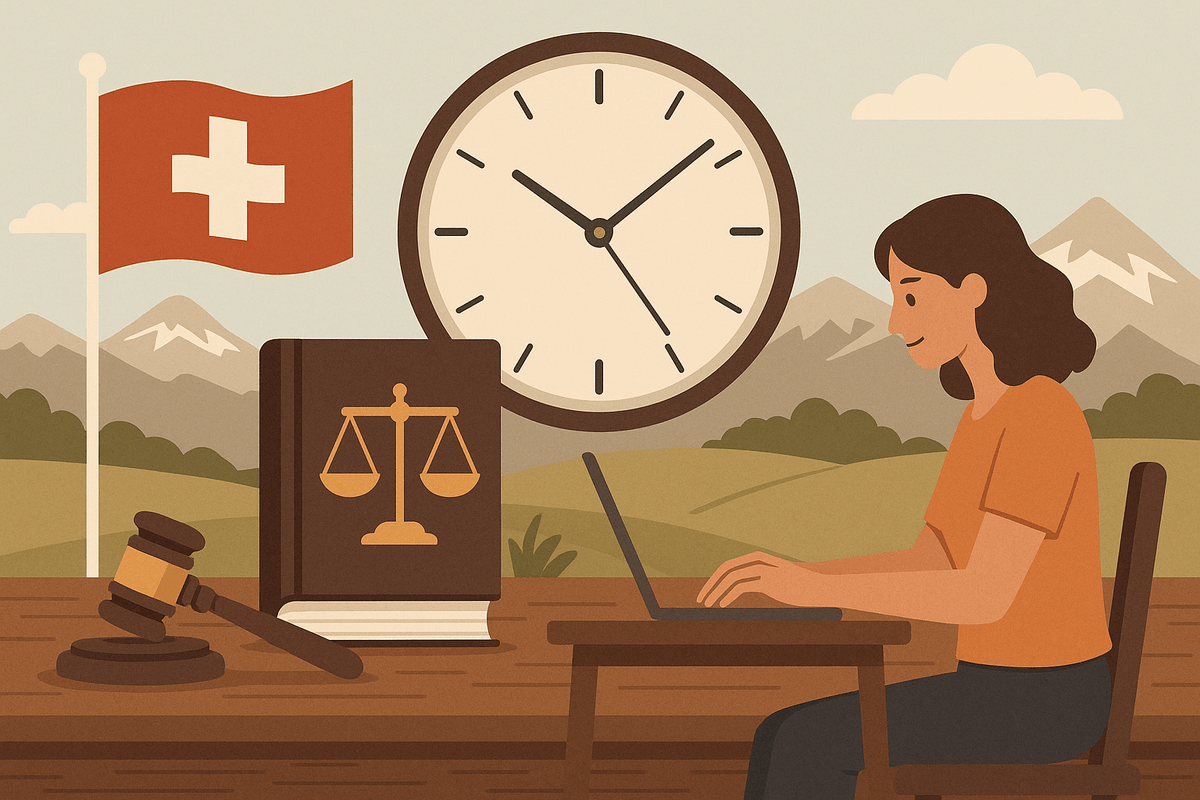Das Schweizer Arbeitsrecht, insbesondere die Arbeitszeit- und Pausengesetze, haben sich von Fabrikschutzmaßnahmen des 19. Jahrhunderts zu einem modernen Rahmen entwickelt, der die Gesundheit und Ausgewogenheit der Arbeitnehmer in den Vordergrund stellt. Das Schweizer Arbeitsgesetz (ArG) schreibt Mindestpausen vor, die sich nach der täglichen Arbeitszeit richten: 15 Minuten bei über 5,5 Stunden, 30 Minuten bei über 7 Stunden und 60 Minuten bei über 9 Stunden. Die wöchentliche Arbeitszeit ist auf 45–50 Stunden begrenzt, mit mindestens 11 Stunden täglicher Ruhezeit.
Diese Regeln gelten jedoch in erster Linie für Arbeitnehmer, nicht für Freiberufler oder Selbstständige, die zwar eine größere Flexibilität genießen, aber auch die volle Verantwortung für ihr eigenes Wohlergehen, ihre soziale Absicherung und ihre Steuern tragen.
Dieser Artikel untersucht die historischen Wurzeln dieser Gesetze, die aktuelle Landschaft und gibt praktische Ratschläge für Schweizer Freiberufler – und bietet gleichzeitig wertvolle Einblicke für Arbeitnehmer, Arbeitgeber und internationale Beobachter, die an einer ausgewogenen Arbeitskultur interessiert sind. Das Verständnis dieser Vorschriften kann dazu beitragen, Burnout zu verhindern, die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen und die einzigartigen Herausforderungen der selbstständigen Arbeit in einer der produktivsten Volkswirtschaften Europas hervorzuheben.